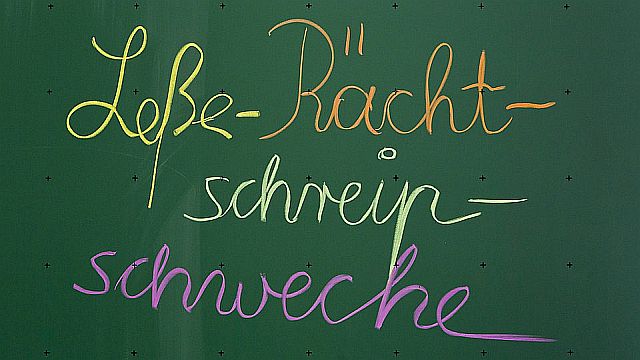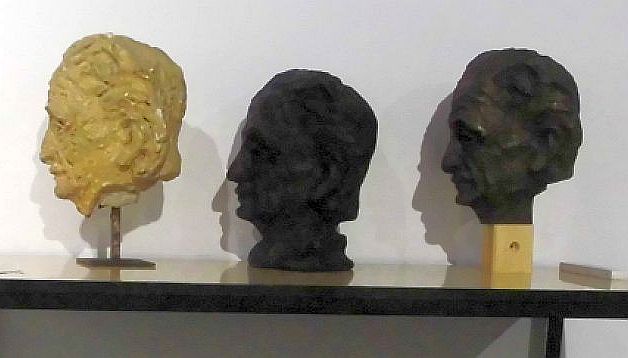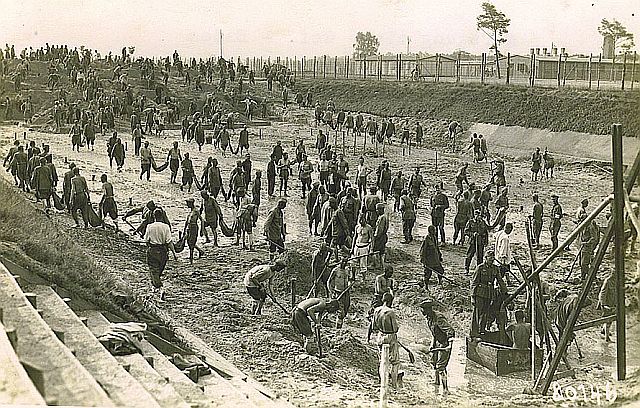Von Wolf Stegemann
30. März 2018. – Der Name Steinmeier ist wegen des gleichnamigen Bundespräsidenten Frank-Walter mittlerweile bundesweit geläufig. In Dorsten-Holsterhausen war in den 1950er-Jahren dieser Name ebenfalls bekannt. Denn August Steinmeier, ein Cousin Walter Steinmeiers aus Brakelsiek im Lipper Land, Vater des eingangs genannten Bundespräsidenten, kam als zweijähriges Kind mit den Eltern 1910 nach Holsterhausen. Er war als Schreiner bei der Baufirma Schaub beschäftigt, ansonsten in etlichen Ehrenämtern aktiv wie im Dorstener Stadtrat und von 1948 bis 1951 als Presbyter in der evangelischen Martin-Luther-Kirche. Er war Schöffe beim Landgericht Essen, Mitglied im Gesangsverein und im evangelischen Kirchenchor, war im Jünglingsverein und hat immer wieder für die Kirche Geld gesammelt. Er setzte sich stets und auch erfolgreich für das Allgemeinwohl ein. Die Familie wohnte in der damaligen Kronprinzenstraße, heute Breslauer Straße, wo dessen Tochter Liselotte, verwitwete Topp und Großcousine (Cousine 2. Grades) des Bundespräsidenten, heute mit 80 Jahren noch lebt. Ihr Haus, gleich neben ihrem Elternhaus, hat zwei Eingänge: Einer von der Breslauer Straße und einer von der Martin-Luther-Straße, die bis 1953 Königstraße hieß. Für deren Umbenennung kämpfte ihr Vater August Steinmeier. Seine Tochter, die 1951 konfirmiert wurde, erinnert sich: „Mein Vater war ein Kämpfer. Überspitzt gesagt kämpfte er für jede Straßenlaterne. Er kümmerte sich als Stadtrat aber auch darum, dass in Holsterhausen damals die Straßen geteert wurden.“ Als er 1998 in Holsterhausen starb, kam zu dessen Beerdigung im Waldfriedhof Holsterhausen sein noch lebender Cousin Walter mit Sohn Frank-Walter. Weiterlesen